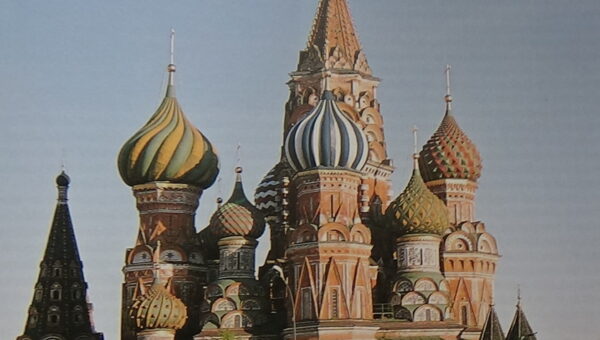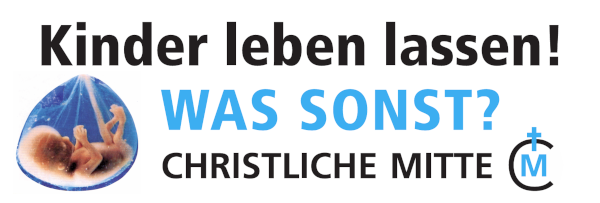Das Leinentuch zeigt den Leichnam JESU: Auf mystische Weise sind nicht nur der Körper JESU darauf zu sehen, sondern auch seine Wundmale. 2025 ist es wieder 10 Tage lang für die Öffentlichkeit zur Verehrung ausgestellt.
Forscher im 20. Jahrhundert haben längst erklärt, daß das Abbild JESU kein Gemälde ist, sondern ein Wunder. Was wissen wir aus der Bibel über die Grablegung JESU am Karfreitag? Die beiden Juden und Freunde JESU – Josef und Nikodemus – legen den Leichnam in ein neu ausgehauenes Felsengrab vor den Mauern Jerusalems, einbalsamiert mit Aloe und Myrrhe, 32 Kilogramm, darüber legen sie das fast 4,5 Meter lange Tuch. Dann rollen sie den Verschlußstein vor den Eingang des Grabes. Als Maria Magdalena und Petrus und Johannes nacheinander morgens früh zum Grab eilen, ist es leer. Da liegen nur noch das Leinentuch und das Schweißtuch vom Kopf im Grab, welche die Jünger eilig als kostbare Andenken mitnehmen.
Was geschah mit dem Grabtuch?
Petrus, der Stellvertreter JESU und erster Papst, nimmt das Tuch mit nach Rom. Dann verlieren sich die Spuren während der nächsten 300 Jahre wegen der Christenverfolgungen im Imperium Romanum. Wahrscheinlich gelangte das Grabtuch in den Verfolgungs‐Wirren nach Edessa im Byzantinischen Reich. Denn aus dem Jahr 600 wird aus Edessa berichtet, daß ein „nicht von Menschenhand gemachtes Bild“ die Stadt aus der Belagerung durch die Perser befreit habe. Wissenschaftlich nachgewiesen ist der Aufenthalt des Grabtuches JESU erst wieder um das Jahr 1525 in der Kathedrale von Turin, in San Giovanni Battista. 1898 fotografiert der Amateur‐Fotograf Secondo Pia erstmals das Tuch: Zu sehen ist ein etwa 30jähriger, vollbärtiger toter Mann mit Spuren der Kreuzigung und zahlreichen Wunden. Das Grabtuch ist gleichsam das Foto‐Negativ. Ein Wunder.
Das Grabtuch ist echt
Auf beiden Augen des toten JESUS liegen Münzen aus dem 16. Jahr der Regierung des römischen Kaisers Tiberius (29 n.Chr.), die nur zur Zeit des Landpfleger Pontius Pilatus geprägt wurden. Dann weiter: Das Tuch enthält keinerlei Farb‐ oder Verwesungsspuren. 50 Dornenstiche am Kopf sind klar zu erkennen und weisen auf die Dornenkrone hin, die JESUS von römischen Soldaten zur Verspottung aufgesetzt wurde. Auch Spuren der Geißelung sind zu erkennen: 120 Einschläge von zwei Seiten durch kleine Bleikugeln. Auf der Schulter Druckspuren von dem 50 Kilogramm schweren Querbalken des Kreuzes, den JESUS zur Kreuzigung tragen mußte. An der rechten Ferse JESU Straßenschmutz, wie er in Jerusalem vorkam. Die rechte Wange ist geschwollen, der Bart zum Teil ausgerissen. Das Tuch enthält Spuren von Myrrhe und Aloe.
Beweise der Forschung
Der Schweizer Kriminologe Max Frei entnimmt 1973 mit Klebestreifen 59 verschiedene Pollenkörner vom Grabtuch, deren Pflanzen nur im Nahen Osten zur Zeit JESU vorkommen: 44 Pollenarten davon stammen aus Jerusalem, 18 aus Edessa, 13 aus Konstantinopel und 17 aus Italien, also Orten, wo das Grabtuch lagerte. Auch die Blutspuren auf dem Tuch können wissenschaftlich nachgewiesen werden: Es handelt sich um die Blutgruppe AB. Die Lanzenwunde, von welcher die Evangelien berichten, ist zu sehen. Die Qualen JESU sind im Tuch abgebildet: Blutungen in den Füßen, durchbohrte Handwurzeln. Entsprechend der Kreuzigungs‐Art zur Zeit JESU.
Wem gehört das Grabtuch?
Seit 1983 ist das Turiner Tuch im Besitz des Vatikan, dem es der italienische König Umberto II. in seinem Testament vermacht hat. Im 20. Jahrhundert wurde die kostbare Grabtuch‐Reliquie in Turin viermal den Gläubigen zur Verehrung gezeigt: So auch im Jahr 2015 und im April 2025, im Heiligen Jahr. Das Grabtuch ist das weltweit am intensivsten untersuchte Textilstück. Bis heute bestärkt es die Christenheit im Glauben an das Leidens‐ und Auferstehungs‐Mysterium JESU CHRISTI.
Sr. M. Anja Henkel Buch: Das Grabtuch von Turin (15 €)